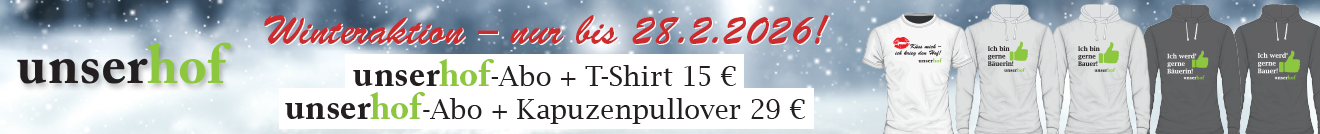„Reine Forstwirtschaft wäre herausfordernd“
Der Vorstand der Österreichischen Bundesforste, ANDREAS GRUBER, ist Herr über 510.000 Hektar Staatswald. STEFAN NIMMERVOLL hat ihn anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Unternehmens zum Interview gebeten.
Die EU-Entwaldungsverordnung wurde erneut verschoben. Sind Sie erleichtert?
Wir begrüßen die neuerliche Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung, für die sich insbesondere Bundesminister Norbert Totschnig erfolgreich auf EU-Ebene eingesetzt hat. Was den Herkunftsnachweis betrifft, sind die Bundesforste dank der durchgehend digitalen Lieferkette zwar bereits jetzt gut aufgestellt. Dennoch wäre der zusätzliche bürokratische Aufwand für die gesamte Branche enorm.
Wie groß wird der Mehraufwand sein, der dadurch entsteht? Tun sich große Einheiten wie die Bundesforste mit der EUDR leichter als kleine Waldbauern?
Für uns wäre der Aufwand bewältigbar gewesen, da wir bereits die entsprechenden Daten zur Verfügung haben. Einen großen Nutzen sehen wir in der Verordnung aber nicht. Wir sind dafür, dass global etwas gegen die Entwaldung unternommen wird, aber definitiv woanders als in Österreich. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung hat bei uns eine lange Tradition und die Walderhaltung ist auch gesetzlich verankert. Die Verordnung würde viele Waldbesitzer vor unverhältnismäßige bürokratische Herausforderungen stellen.
Viele Bauern verlieren mit der Bürokratie und den immer wiederkehrenden Kalamitäten die Freude an ihrem Wald. Verstehen Sie, dass sie in der Arbeit keinen Sinn mehr sehen, wenn auf absehbare Zeit kein Ertrag mehr damit zu erzielen ist?
Das ist schwer zu vergleichen. Da kommt der Unterschied zwischen Waldbesitzern, die zwei Hektar bewirtschaften und jemandem wie der ÖBf AG, die große, zusammenhängende Flächen verwaltet, zum Tragen. Unsere Kernaufgabe ist die Anpassung der Wälder der Bundesforste an den Klimawandel. Dazu werden wir alle notwendigen Maßnahmen weiterhin konsequent umsetzen.
Das Landwirtschaftsministerium muss seine Budgets neu strukturieren. Der Haupteinsparungsposten dabei ist der Waldfonds. Ist es klug, in Zeiten wie diesen im Forst zu sparen?
Wir sind davon eher weniger tangiert, weil wir Mittel aus dem Waldfonds nur für besondere Forschungsprojekte bekommen. Wir finanzieren den Waldumbau aus eigener Kraft und haben uns dafür in den letzten Jahrzehnten gut aufgestellt. Wir sind ein diversifizierter moderner Forstbetrieb, der auch in Immobilien und erneuerbare Energie investiert. Wir bieten auch Dienstleistungen an und können so, die Schwankungen in der Holzwirtschaft abpuffern.
Braucht es diese Diversifizierung, um künftig überhaupt noch Dividenden an den Bund ausschütten zu können?
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Strategie der Diversifizierung den richtigen Weg gegangen sind. Die Bedingungen am Holzmarkt hängen sehr stark von Schadereignissen ab. Bei einem sehr hohen Angebot an Schadholz sinkt der Holzpreis und die Holzerntekosten steigen. Wenn man dann Schadholz zu bewältigen hat, geht somit die Schere auf und mit reiner Forstwirtschaft wird es wirtschaftlich sehr herausfordernd.
Zumindest ist der Schadholzanteil im heurigen Jahr geringer als zuvor. Ist das schlicht Glück oder auch das Resultat eines besseren Managements?
Wenn es mehr Stürme gibt, fällt mehr Wald um. Kurzfristig lässt sich daran nichts ändern. Was man aber machen kann, ist die Baumartenzusammensetzung verändern und zum Beispiel verstärkt Lärchen zu setzen, die ein stärkeres Wurzelsystem haben. Was die Borkenkäferkalamitäten betrifft, ist unser Ziel das Schadholz möglichst schnell aus dem Wald zu bringen. Wir entrinden Kleinmengen, die nicht durch Holzerntemaschinen erreichbar sind und setzen gezielt waldbauliche Maßnahmen, um den Wald stabilisieren. Dabei setzen wir viel auf Durchforstungen. Diese macht mittlerweile rund 40 Prozent unseres Einschlages aus.
Können Sie ihren Jahreseinschlag angesichts der großen Kalamitätenmengen überhaupt noch planen oder reagieren sie nur noch auf Notfälle?
Derzeit haben wir 53 Prozent Schadholzanteil. 47 Prozent sind also geplante Maßnahmen. Ein guter Plan ist aber natürlich dafür da, dass man ihn anpassen kann.
In Osttirol, wo die Bundesforste nicht aktiv sind, muss man ganze Täler aufgeben und sich selbst überlassen. Ist es in ihren Einzugsgebieten gelungen, alle Schadflächen zeitgerecht aufzuarbeiten?
Wir verzeichneten vergangenes Jahr 75 Prozent Schadholz – hauptsächlich Sturmholz –und haben das konsequent abgearbeitet. Mit den uns zur Verfügung stehenden externen und internen Kapazitäten ist uns das gut gelungen.
Gibt es überhaupt genug Unternehmen, die die Aufarbeitung übernehmen können?
Bei Harvestern ist es einfacher. Für ein Gelände wie in Osttirol ist es aber schwierig, ausreichende Seilkapazitäten zu bekommen. Wir werden unsere Bundesforste-eigenen Seilgeräte daher auf 12 verdoppeln, damit wir für die rasche Aufarbeitung von kleinen Schadholzflächen schlagkräftiger sind.
Wie wird der Wald der Zukunft aus Sicht der Bundesforste aussehen?
Er wird artenreich und bunt sein: Mehr Laubbaumarten, mehr Struktur, alt und jung nebeneinander. Wir wollen die Fichte von 60 auf 40 Prozent senken. Das ist aber kein Sprint, sondern ein Marathon, weil die Forstwirtschaft in anderen Zeiträumen taktet. Ein Baum wird erst nach 100 bis 120 Jahren geerntet. Dementsprechend lange dauert der Waldumbau.
Ist es überhaupt möglich, zu prognostizieren, was bis zur Hiebreife die richtige Baumartenmischung sein wird? Die Großväter haben auch geglaubt, dass sie mit der Fichte gut fahren werden.
Die Forstwirtschaft und die Holzwirtschaft sind mit der Fichte über Jahrhunderte hinweg sehr gut gefahren. Die Forstwirtschaft hat sich den Klimawandel aber nicht ausgesucht. Sie ist ein Betroffener. Wir versuchen die Szenarien in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft bestmöglich zu rechnen und für jedes Revier eine Baumartenzusammensetzung zu finden, die passt. Alle zehn Jahre machen wir für jedes Forstrevier Waldwirtschaftspläne, in denen wir festlegen, wie es weitergeht.
Naturverjüngung oder Auspflanzung?
Beides. Wir setzen sehr viel auf Naturverjüngung, weil die Pflanzen vor Ort an den Standort angepasst sind und sich leichter tun. Deshalb forsten wir nur mit 1,4 Mio. Jungbäumen pro Jahr auf. Das wird aber mehr werden, weil wir da und dort Baumarten wie die Lärche, Eiche und die Douglasie einbringen, die auf einigen Flächen nicht für die natürliche Verjüngung verfügbar sind.
Wird die Versorgung der Sägewerke langfristig sicherstellbar sein, wenn sich die Waldzusammensetzung ändert?
Mit unserem Ziel von 40 Prozent Fichte werden wir immer noch große Mengen an österreichische Sägewerke liefern können. Darüber hinaus ist die österreichische Holzindustrie weltführend und gut aufgestellt. Sie wird sich darauf einstellen, dass es mehr Laubholz und mehr Lärche und Tanne geben wird, und gemeinsam mit der Holzforschung auch völlig neue Anwendungen für viele Holzarten finden.
Jahrelang hat man von der wichtigen Funktion des Waldes als Kohlenstoffsenke gehört. Jetzt soll er plötzlich ein CO2-Emittent sein. Was ist jetzt richtig?
Wichtig ist, dass wir den Wald aktiv bewirtschaften und so an die Änderungen des Klimawandels anpassen. Dabei wollen wir nicht mehr nutzen als zuwächst. Wir haben 2023 650.000 Tonnen CO2 Nettosenke gehabt. 2024 mussten schadholzbedingt mehr nutzen und haben einer Nettosenke von 517.000 Tonnen erreicht. Es ist nach wie vor so, dass unser Wald mehr CO2 bindet als er abgibt.
Und wenn man über die Bundesforste hinausschaut?
Je älter der Wald wird, desto weniger CO2 baut er ein. Wenn er dann zusammenbricht, und noch kein Jungwald vorhanden ist, der dem Klimawandel gewachsen ist, fällt die Bilanz schlechter aus.
Aus Klima-Sicht ist ein Urwald in Mitteleuropa also gar nicht sinnvoll?
Wir sind überzeugt, dass ein aktiv bewirtschafteter Wald, die Funktionen, die von ihm erwartet werden, am besten erfüllen kann; nicht nur als CO2-Speicher, sondern auch als Wasserspeicher, als Erholungs- und Wohlfahrtsort und Schutz vor Naturgefahren.
Wie beurteilen Sie unter all den genannten Aspekten die Zukunft der Forstwirtschaft und der Bundesforste?
Wir haben einen klaren Plan. Den setzen wir um.
Seit November 2022 steht DI Andreas Gruber als Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz gemeinsam mit Vorstandssprecher Mag. Georg Schöppl an der Spitze der Österreichischen Bundesforste. Der gebürtige Salzburger ist studierter Forstwirt und seit mittlerweile 27 Jahren in unterschiedlichen Positionen, unter anderem als langjähriger Leiter des Forstbetriebs Traun-Innviertel, im Unternehmen tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
www.bundesforste.at