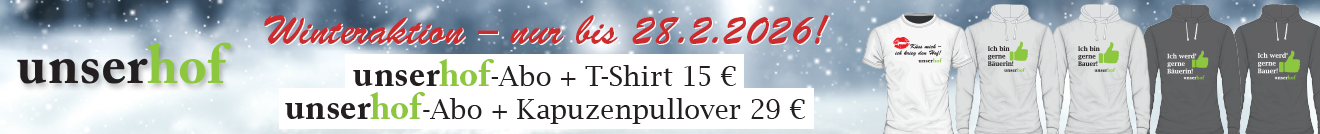„Landwirtschaft ist mehr als nur Landwirtschaft“
Bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums referierte der Direktor des Brüssel-Büros der Welternährungsorganisation FAO, RASCHAD AL KHAFAJI, über den Hunger in der Welt. STEFAN NIMMERVOLL hat ihn zur entscheidenden Rolle der bäuerlichen Familienbetriebe befragt.
Wie ist der aktuelle Status der Welternährung?
In der Vergangenheit hat sich die Anzahl der hungrigen Menschen stetig verringert. Doch leider sehen wir seit der Corona-Pandemie wieder einen Anstieg, der dazu führte, dass im Jahr 2023 733 Millionen Menschen nicht wussten, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen. Das bedeutet, dass jeder elfte Mensch auf der Welt heutzutage hungert. Die Anzahl der Menschen, die sich nicht regelmäßig die günstigste gesunde Nahrung leisten können, ist mit etwa 2,81 Milliarden sogar noch weit höher.
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Wir dürfen unseren Fokus nicht nur auf den kalorischen Wert einer Mahlzeit legen, sondern müssen immer stärker auch auf den gesundheitlichen Aspekt achten. Wir müssen das gesamte Agrar- und Ernährungssystem ändern. Die heutigen Systeme erfüllen ihren Zweck nicht mehr, weil sie nicht nur Unterernährung, sondern auch schlechte Ernährung produzieren, die zu vielen gesundheitlichen Problemen von Übergewicht bis zu Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes führt; Letzteres betrifft ganz besonders die entwickelten Länder.
Prognosen sagen voraus, dass die Erde bald von sogar zehn Milliarden Menschen bevölkert wird. Wie wird es gelingen, diese zu ernähren?
Wir müssen den Tisch für mehr Menschen decken. Das heißt aber nicht, einfach die Quantität unserer Produktion zu erhöhen. Wir müssen Verlust, Verschwendung und Verteilung in die Gleichung mit einbeziehen. Wir sprechen hier von aktuell mehr als 35 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Produktion, die nicht bei Menschen ankommen und mit denen wir die jetzige Hungersnot beenden könnten. Die Erde produziert genug. Es geht aber darum, ob ich mir das Essen leisten kann und ob es in dem Dorf, in dem ich lebe, auch ankommt. Es gibt vielerlei Engpässe, die auf dem Weg vom Feld zum Teller zu überwinden sind.
Der agrarische Output wird aber ebenfalls steigen müssen.
Einfach so wie jetzt, nur mehr zu produzieren, wird sich nicht ausgehen. Wir haben die Ressourcen dazu nicht. Wir müssen intelligenter produzieren; das heißt mehr Output mit weniger Input. Wir müssen auf Innovationen und neue Technologien setzen. Da geht es nicht immer gleich um Drohnen oder Roboter, sondern auch um Ansätze in Organisationsprozessen, damit man eine höhere Produktivität erreicht.
Haben Europa und Österreich einen Versorgungsauftrag für die Welt?
Als internationale Gemeinschaft hat die gesamte Welt den Auftrag, dass niemand auf diesem Planeten hungert oder von Anfang an dazu verdammt ist, ein kränkliches Leben zu führen. Es gibt aber keine konkrete Region A, die eine Region B versorgen muss. Solidarität ist ein globaler Ansatz.
Wer ernährt die Welt? Der bäuerliche Familienbetrieb, wie in Österreich, oder die Agrarindustrie?
Es wird immer beides geben. Die FAO ist aber ein starker Verfechter der kleinbäuerlichen Strukturen. Man unterschätzt, dass diese einen wichtigen Beitrag zur Welternährung leisten. Es ernähren uns die Familienbetriebe. Die Landwirtschaft ist auch nicht mit anderen Sektoren, wie etwa der Autoindustrie, zu vergleichen. Lebensmittelproduktion ist mehr: sie ist immer auch Identität, sie ist Kultur und sie transportiert Geschichte. Wie und was wir essen, geht weit über den wirtschaftlichen Rahmen hinaus.
Es braucht also mehr Augenmerk auf die Millionen Familien am Land?
Wir müssen Dörfer so stärken, dass Bauern dort bleiben und die kleinen Betriebe nicht aussterben. Das müssen wir aber mit modernen Mitteln tun. Eine der Hauptinitiativen der FAO liegt im Bereich der digitalen Landwirtschaft, in dem zum Beispiel Weiterbildungen oder Versicherungen, aber auch veterinärmedizinische Informationen über das Internet angeboten werden.
Braucht es auch bei uns ein Umdenken im Umgang mit der Landwirtschaft?
Wir sind in der wohlhabenderen Welt durch eine Phase gegangen, in der wir die Lebensmittelversorgung als dermaßen gegeben angenommen haben, dass wir uns keine Gedanken mehr gemacht haben, was es im Hintergrund alles braucht, bis ein Produkt zu uns kommt. Die Menschen waren während der Corona-Zeit anfangs komplett erstaunt, als es plötzlich leere Regale im Supermarkt gab. Umso wichtiger ist, dass es ein gesamtgesellschaftliches Umdenken gibt, damit den Bäuerinnen und Bauern wieder eine positiv behaftete Rolle gegeben wird, die mit einer gewissen Dankbarkeit und Anerkennung verbunden ist.
Die Bauern wünschen sich hohe Preise. Für viele Menschen sind die Lebensmittel dann aber unerschwinglich. Lässt sich dieser Widerspruch auflösen?
Es gibt keine einfache mathematische Lösung. Einerseits geht es darum, sich als Gesellschaft bewusst zu machen, dass es nicht in ihrem Interesse ist, das Einkommen der Bauern so stark zu drücken, dass es sich nicht mehr lohnt, Bauer zu sein. Andererseits sollte es so sein, dass der Preis für die Menschen erschwinglich bleibt. Wie man diese Balance finden kann, ist eine große Frage, die sicher auch jeder Politiker gerne beantworten können würde.
Hat die Gesellschaft die strategische Bedeutung einer Ernährungssouveränität genug im Blick?
Auch reiche Länder haben gemerkt, dass man das Geld nicht essen kann, sondern dass es jemanden braucht, der produzieren und verkaufen will. Jedes Land wird sich daher fragen müssen, woher in Zukunft seine Lebensmittelversorgung kommt, welchen Teil davon es im eigenen Land garantieren kann und welche Ansätze es gibt, um das zu stärken. Wir müssen alle schauen, dass ein großer Teil dessen, was wir essen, aus der näheren Umgebung kommt; auch aus ökologischen Gründen. Es gibt zum Beispiel Länder, die sehr stark in Aquakultur investieren, weil sie das als eine sichere Methode sehen, um Lebensmittel für den eigenen Markt zu haben.
Die Bauernschaft lehnt Freihandelsabkommen wie Mercosur strikt ab. Zugleich spricht Donald Trump von neuen Zöllen. Ist eine Renationalisierung eine Gefahr für die Welternährung?
Die FAO kommentiert politische Prozesse nicht. Was ich sagen kann: Multilateralismus ist wichtig. Wir brauchen eine Plattform, auf der wir miteinander reden können und auf der wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Der Weg der Isolierung eines Landes oder der politische Ansatz, zu sagen, ich möchte nicht mehr Teil dieser oder jener Gemeinschaft sein, wird uns nicht weiterbringen.
Welche Auswirkungen hat denn der Ukraine-Konflikt auf die weltweite Versorgungslage?
Der Ausbruch des Krieges Ende Februar 2022 führte zu unmittelbaren Störungen des Weltmarktes, indem er Handelslogistik und Transportwege beeinträchtigte. Die beiden Länder zählen weltweit zu den größten Erzeugern von Agrarrohstoffen. Sie sind wichtige Exporteure von Grundnahrungsmitteln in viele Länder, die zur Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung in hohem Maße von Lebensmittelimporten abhängig sind. Darunter sind viele Entwicklungsländer und einkommensschwache Länder mit Nahrungsmitteldefizit. Der Krieg hat die Kapazitäten beider Länder beeinträchtigt, bestehende Exportverträge zu erfüllen und neue Verträge für bereits geerntete Erzeugnisse abzuschließen. Aus heutiger Sicht lässt sich aber feststellen, dass das geringere Angebot von Weizen aus Russland und der Ukraine von anderen Ländern aufgefangen wurde. Der Markt war flexibel genug, diese Verknappung auszugleichen. Was langfristig gesehen zu größeren Problemen führte, war allerdings die Steigerung von Preisen bei Düngemitteln, weil da der Markt sehr stark in der Hand von einigen wenigen Ländern ist.
Wie beeinflusst der Klimawandel den Hunger in der Welt?
Im Jahr 2023 bedrohten extreme Wetterereignisse wie Hitze, Dürrewellen, Waldbrände, starke Regenfälle und Überschwemmungen die akute Ernährungssicherheit von 72 Millionen Menschen in 18 Ländern, und das oft in solchen, die zusätzlich von Konflikten betroffen waren. Die Landwirtschaft ist daher bei den Weltklimakonferenzen ein extrem wichtiges Thema geworden. Sie wird mittlerweile viel mehr als Teil der Lösung und nicht nur als Teil des Problems gesehen.
Klimaschutz bedeutet aber oft auch, auf Erträge zu verzichten.
Es muss die Balance zwischen zwei Zielen, die sich die internationale Gesellschaft gesetzt hat, gefunden werden; einerseits das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens, andererseits die globale Ernährung. Es gibt keinen Satz von Lösungen, der auf der ganzen Welt für jedes einzelne Land funktionieren kann. Wir leben in einem Land, in dem die Ernährungssicherheit gegeben ist, während die Lebensmittelversorgung in Ländern des globalen Südens ein Problem ist. Der Senegal wird kaum erheblich zur globalen Erwärmung beitragen, hat aber vielleicht eher Probleme, die Ernährungssicherheit seiner Bevölkerung zu garantieren.
Die Verantwortung Europas ist also ungleich höher.
Alle entwickelten Länder tragen einen größeren Teil der Verantwortung. Natürlich kann es sich ein Land wie Österreich mehr leisten, auf die Umwelt zu schauen, weil wir keine hungernde Bevölkerung haben. Sie müssen sich aber in die Lage eines Politikers in einem Land versetzen, in dem ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung unterernährt ist und es zu Hungersnöten kommt. Der wird kaum vor sein Parlament treten können und sagen „So, jetzt müssen wir etwas für unsere Umwelt tun und die Erderwärmung bekämpfen.“
Welche Vision haben Sie für die Zukunft der Ernährung?
Der Lösungsansatz der FAO basiert auf vier Verbesserungen: Bessere Produktion für eine bessere Ernährung in einer besseren Umwelt für ein besseres Leben, das niemanden zurücklässt. Landwirtschaft, Ernährung und Ernährungssicherheit müssen ein gesamtgesellschaftliches Konzept werden. Landwirtschaft ist mehr als nur Landwirtschaft. Die gesamte Kette muss verändert werden. Das verkompliziert die Sache, weil ich nicht nur mit dem Landwirtschaftsministerium, sondern auch mit dem Gesundheitsministerium, dem Handelsministerium, den Städteverwaltungen und den Regionen zusammenarbeiten muss. Die Lösung für die komplexe Herausforderung, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, liegt also in vielen Ebenen.
Raschad al Khafaji ist der Sohn eines Irakers und einer Kärntnerin. Er begann seine Laufbahn vor mehr als dreißig Jahren beim Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV) und arbeitete danach bei der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) und der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO). Im Jahr 2003 wechselte er zur Welternährungsorganisation, FAO, wo er nach verschiedenen Stationen seit 2020 Direktor des Verbindungsbüros mit der Europäischen Union und Belgien ist.