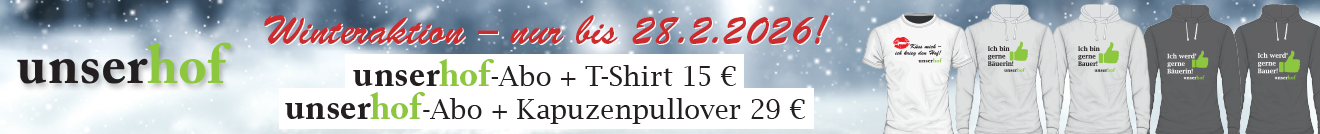Ignoranz bedroht Traminer-Hochburg
Im steirischen Weinbau herrscht aufgrund der Goldgelben Vergilbung Alarmstimmung. Man spricht von der größten Gefahr seit der Reblaus-Katastrophe. STEFAN NIMMERVOLL war im Vulkanland.
Die Laune war schon einmal besser in Klöch, der „Perle des südoststeirischen Weinbaus“, wie sich die Gemeinde selbstbewusst nennt. Denn unter den Weinbauern geht die Angst vor der Amerikanischen Rebzikade um. Die von ihr übertragene Goldgelbe Vergilbung führt zwangsläufig zum Absterben der befallenen Rebe und gilt als hochansteckend. Zeigt eine Pflanze Symptome, muss sie unverzüglich ausgerissen werden, damit der Schädling die Phytoplasmen nicht über seinen Speichel weiter verschleppt. „Aber es gibt Leute, die gehen an befallenen und gekennzeichneten Stöcken vorbei und schneiden sie im Winter sogar wieder an“, ist Winzer Lukas Domittner zornig. Von seinen zehn Hektar hat er bereits tausend Exemplare entfernt. „Wir gehen in der Vegetationsperiode mehrmals durch. Mittlerweile reißen wir den Rebstock links und rechts ebenfalls aus, weil er sowieso meist schon infiziert ist.“ Diesen Eifer legen aber nicht alle Kollegen an den Tag; geschweige denn Privatpersonen, die ein paar Reben vor ihrem Haus haben.
Domittners Kampf blieb daher bisher eine Sisyphos-Aufgabe. Bei einer Rundfahrt durch die Rieden der Traminer-Hochburg zeigt der Jungwinzer Anlagen, die fast völlig von der Flavescence Dorée (so die elegantere Bezeichnung der Krankheit) durchseucht sind. „Wir sind auf die Rebzikade erstmals 2004 aufmerksam geworden. Sie ist über den Balkan zu uns zugewandert“, erklärt der steirische Weinbaudirektor Martin Palz. Dort und im angrenzenden Ungarn gebe es viele unbewirtschaftete Weingärten, die optimale Brutstätten abgeben. 2009 gelang dann auch der Erstnachweis der Quarantäne-Krankheit. Intensiv getroffen wurde man in Klöch vom Problem sich vergilbender und einrollender Blätter aber erst vor rund fünf Jahren. Seither verlief die Entwicklung explosionsartig. „Hier und in Bad Waltersdorf haben wir ein geschlossenes Befallsgebiet“, so Palz. Heuer wurden auch im benachbarten Südburgenland viele Nachweise getätigt. Nur in der Südsteiermark bleibt das Befallsgebiet vorerst in etwa gleich.
Begünstig wird die Ausbreitung der Zikade durch wärmere Temperaturen und mildere Winter. Zwar sind Weinbaubetriebe und Hausbesitzer schon seit 2010 verpflichtet, befallene Reben zu melden. Das geschah aber nur sporadisch. Auch wurden, erstmals in Österreich, zwei Pflanzenschutzmaßnahmen mit Insektiziden zwingend vorgeschrieben. Von manchen wurde auch das aber geflissentlich ignoriert. Die Handhabe gegen schlampig gearbeitete oder gar verwilderte Weingärten war begrenzt. Auf Druck jener Betriebe, die auch weiterhin im Vollerwerb vom Weinbau leben wollen, wurde nun aber eine Taskforce im Land Steiermark eingerichtet. Seit kurzem streifen amtlich geschulte Kontrollorgane durch die Fluren, besprayen kranke Stöcke und entnehmen Triebe, die dann von der AGES untersucht werden.
Einer davon ist der Weinbauer Gabriel Ortner aus Straß, das rund 30 Kilometer vom Hotspot Klöch entfernt liegt. „Ich war daheim mit der Ernte fast fertig, darum habe ich mich gemeldet, um meinen Beitrag zur Eindämmung zu leisten und zu verhindern, dass die Goldgelbe Vergilbung auch auf uns übergreift“, sagt er. Vorerst bis zum Jahreswechsel dauert sein Dienstverhältnis. Was er beprobt und markiert hat, muss bei Nachweis der Krankheit nach bescheidmäßiger Anordnung des Amtlichen Pflanzenschutzdienst binnen vier Wochen entfernt werden. Sind es in einem Weingarten mehr als 20 Prozent der Stöcke, ist dieser vollständig zu roden. Bei Nichtbefolgung stehen Strafen bis zu 30.000 Euro im Raum. Wem die Kultur gehört, weiß Ortner dabei nicht. „Ich sehe nur die Katastralgemeinde und die Parzellennummer.“
Lukas Domittner weigert sich zu akzeptieren, dass sein Betrieb insgesamt in Gefahr ist. „Wir verzichten momentan aber auf Nachpflanzungen, weil die Jungen rasch wieder infiziert werden können. Und wir setzen ja nicht tausend Stöcke nach und dann kommt heraus, dass wir sowieso die ganze Fläche roden müssen.“ Viel mehr hofft er auf die Vernunft seiner Berufskollegen und dass eine letztlich konsequente Strategie die Dynamik bricht. Geholfen wäre auch mit der dauerhaften Zulassung durch gegenseitige Anerkennung weiterer Insektizid-Wirkstoffe innerhalb der EU-Länder. „In den letzten Jahren waren wir aber leider eher mit Streichungen konfrontiert“, sagt Martin Palz.
Die eleganteste Lösung wäre wohl, wenn eine Pheromon-Verwirrmethode gegen die Rebzikade, ähnlich wie gegen den Traubenwickler, entwickelt werden könnte. Das scheint aber noch in weiter Ferne. Bis dahin versucht Palz mit seiner Mannschaft die Ausbreitung auf andere Regionen zu verhindern. Er hat auch einen Tipp für die Weinbauern in noch nicht betroffenen Bundesländern parat: „Seid achtsam in euren Weingärten und entfernt symptomtragende Rebstöcke unverzüglich, bevor es zu einer unkontrollierten Ausbreitung der Goldgelben Vergilbung kommt.“
weingut-domittner.at