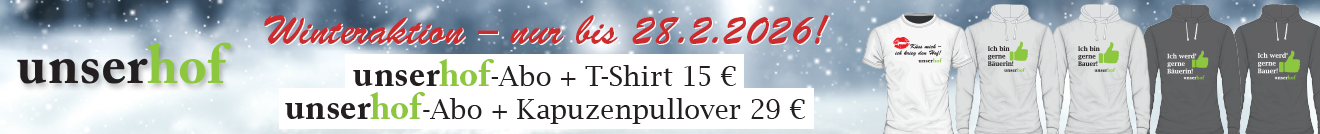Grenznahe Erfahrungen
Die Grenzregion von Litauen zu Weißrussland ist militärischer Vorposten der Europäischen Union. Unter prekären Bedingungen wird aber auch Landwirtschaft betrieben, wie STEFAN NIMMERVOLL bei einer Reise gemeinsam mit Botschaftern der Initiative Farming for Nature erfahren hat.
Das Baltikum war einst die Speisekammer der Sowjetunion. Auf den Kolchosen im Nordosten des Riesenreichs wurde ohne Rücksicht auf die Natur produziert. Traditionelle Gesellschaftsstrukturen wurden dafür zerstört, große Teile der angestammten Bevölkerung nach Sibirien deportiert. Im Kreis Alytus wurden so einerseits Sümpfe trockengelegt, andererseits Fischteiche auf sandigen Böden angelegt. „Eigentlich ist das dort nicht möglich, aber sie wurden permanent mit Wasser aus dem Fluss befüllt, weil Ressourcen keine Bedeutung gehabt haben“, sagt Zymantas Morkvenas, der in dem kleinen Dorf Musteika ein Musterprojekt zur Renaturierung betreibt. Die Teiche sind längst wieder trocken gefallen, dafür ist das Sumpfland wieder vernässt. Auch Sanddünen, die einst aufgeforstet wurden, hat Morkvenas wieder freigelegt.
Der Ökologe, der für seinen Traum die Hauptstadt Vilnius verlassen hat, beweidet die Flächen im Nationalpark Dzukija mit Schottischen Hochlandrinder und hält sie so offen. Wenn sich die Zotteltiere an den Sträuchern reiben, bleibt daran Nistmaterial für die Vögel hängen. „Andere Bauern gibt es keine mehr, das Gebiet wäre zugewachsen und die Artenvielfalt verloren. Von den Weiden aus blickt man auf belrussische Wachtürme. „2018 ist der Stier Columbus ausgebrochen und hat es sogar bis nach Weissrussland geschafft“, erzählt Morkvenas. Er ist auch einer der Motoren für Farming for Nature in Litauen ist, einem Netzwerk, das besonders biodiversitäts-bewusste Höfe vor den Vorhang holen will. Anfänglich war die Motivation für das Projekt alleinig der Naturschutz mit ein paar Tieren Mittlerweile ist mit dem Verkauf des Fleisches auch eine wirtschaftliche Komponente dazugekommen
Einen in die Jahre gekommenen realsozialistischen Stall hat Audrius Jokubauskas 2013 ganz in der Nähe gemeinsam mit Giedrius Tevelis übernommen und begonnen, Rinder und Schafe zu melken. „Wir waren in der Midlife-Crisis. Andere kaufen sich Motorräder, wir Kühe.“ Unter dem Namen Varinis Puodas (Kupferkessel) wird mit einfachsten Mitteln Käse hergestellt, der am Markt in Vilnius Preise von bis zu 36 Euro (bei gleichzeitig viel niedrigerem Lohniveau als in Österreich) erzielt. Seit acht Jahren sind nur mehr Kreuzungen zwischen einer alten litauischen Rasse und Jersey-Rindern am Hof. Nachdem der Kompagnon vor zwei Jahren bei einem schrecklichen Unfall mit einem Stier getötet wurde, hat Jokubauskas die Stückzahl weiter reduziert. Heute verlieren sich gerade noch 17 Milchkühe, von den er im Schnitt 80 Liter pro Tag melkt, in dem gewaltigen Sowjet-Bau. Für ein Rind stehen zwei Hektar Weide, Teile davon auch im Wald, zur Verfügung. „Durch unsere Wirtschaftsweise konnte die Artenanzahl im Grünland auf 60 verdoppelt werden“, freut sich der Käsemacher.
Bei aller Naturnähe bringt die extrem extensive Wirtschaftsweise auch Probleme mit sich. Oft fehlt das Basiswissen. Nach der Wende haben viele ursprüngliche Grundbesitzer ihren Besitz zurückbekommen und nach Gutdünken begonnen, wieder Landwirtschaft zu betreiben. Heute sind es meist nur mehr die Alten, die am Land bleiben. Nerijus Sukackas bemüht sich allerdings, die Familientradition aufrecht zu bewahren. Der hauptberufliche Feuerwehrmann versucht seit acht Jahren mit 17 Rindern und 40 Mutterschafen 84 Hektar Weideland offenzuhalten. „Es kommen immer mehr Sträucher und Beeren auf, die schwer zu entfernen sind“, ist er etwas verzweifelt. Das sandige Dauergrünland sei auch stark erodiert, weil es zu kommunistischen Zeiten mit aller Gewalt als Acker genutzt wurde. Damals durften Sukackas Großeltern einen halben Hektar selbst bewirtschaften und eine Kuh und ein Schwein halten. Sein Ziel ist es, das Land wieder in einen ökologisch wertvollen Zustand zu bringen. „Leider macht uns dabei auch der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung. Es gibt kaum mehr Niederschlag, der nahe See trocknet immer mehr aus und wir können kaum mehr Heu ernten.“
Ein innovativeres System haben der IT-Techniker Andrius Backony und seine Partnerin Raza Pruskovai entwickelt. Sie haben den Hof ihrer Eltern übernommen und weiterentwickelt. In Gewächshäusern wird Bio-Gemüse für den Markt in Vilnius angebaut. Davor picken Hühner Schädling auf und düngen mit ihrem Mist den Boden. Auch das junge Paar konnte viele aufgelassene Nachbarflächen pachten und bestößt sie mit Hochlandrinder. Deren Mist wird händisch aufgesammelt und kompostiert. Zusätzlich wird gemahlenes Gras beigemengt – eine Technik, die in der Sowjetunion Usus war. Viel Wissen haben sich die beiden im Internet bei Youtube-Seminaren aus den USA geholt. „Da ist die Ausbildung zum Teil besser als an der Universität in Litauen“, zuckt Backony mit den Schultern. Noch sei man erst bei 80 Prozent dessen, was man plant. „Wir sehen aber in jedem Fall, dass wir viel weniger Erosion haben als unsere Nachbarn.“
Insgesamt zeigen die Farming for Nature-Vorzeigebetriebe, dass an sowohl geografischen als auch pflanzenbaulichen Grenzstandorten Landwirtschaft möglich ist und sich diese sogar besonders dafür eignen, auf Biodiversität und Naturnähe zu achten. Zugleich werden die unterschiedlichen Standards innerhalb der Europäischen Union sichtbar – sei es bei der Hygiene in der Käseerzeugung oder bei der Ausbildung der Bauern. Im Rahmen des Projektes Farming for Nature ist also Wissenstransfer ein Schlüssel, um den litauischen Kollegen weiterzuhelfen. Auch für die österreichischen Gäste sind die Hofbesuche aber horizonterweiternd: Mögen die Vorbedingungen auch noch so widrig sein, ist es möglich, sich auf das Abenteuer Landwirtschaft einzulassen und das Beste daraus zu machen.
www.farmingfornature.at