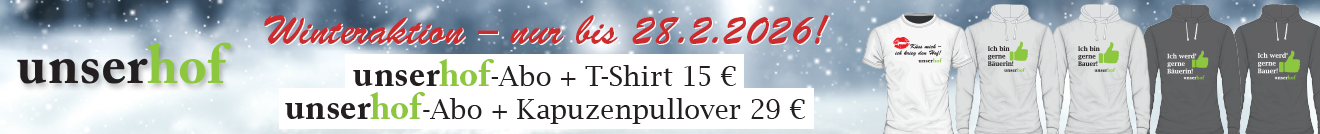Enteignungsphantasien im Land der „besten Farmer der Welt“
Südafrika ist ein Land der immensen sozialen Gegensätze. Die Regierung will dem mit Landreformen und Enteignungen weißer Farmer entgegentreten. STEFAN NIMMERVOLL hat in der Provinz Limpopo nachgefragt, was hinter diesem „Expropriation Act“ steckt
Es war wieder einmal Donald Trump, der für Aufsehen gesorgt hat. Die weiße Minderheit im Land am Kap werde ungerechtfertigt rassistisch bedroht, er verspreche, diese als Flüchtlinge aufzunehmen und sie schnell einzubürgern, tönt der erratische US-Präsident im Frühjahr. Jeder, der fliehen wolle, sei willkommen. Ursache für Trumps Zorn war die Unterzeichnung eines Gesetzes durch Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa, das die Enteignung von Land vereinfachen sollte. Damit einhergehend froren die USA Auslandhilfen, im Jahr 2024 immerhin 323 Mio. Dollar, ein. Doch hat Trump recht?
Wie immer ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte angesiedelt. Denn im öffentlichen Interesse ihren Besitzern weggenommen sollen einerseits in erster Linie Flächen werden, die der Staat für Infrastrukturprojekte braucht – und das gegen Entschädigungen, erklärte die Regierung. Ein Vorgang, der auch in anderen Demokratien so stattfindet. Nur im Extremfall soll das nun auch ohne finanzielle Gegenleistung erfolgen können. Andererseits versucht man aber auch tatsächlich Agrargrundstücke von der reichen weißen Elite zur teils bettelarmen schwarzen Mehrheit umzuverteilen. Dieser Prozess steht seit dem Ende der Apartheid auf der Agenda der Politiker des African National Congress, ANC, von Nelson Mandela bis zu Ramaphosa. Das Gesetz könnte der Idee einer gerechteren Verteilung neuen Schwung geben.
Einer derjenigen, die davon betroffen sein könnten, ist Zander Ernst mit seiner Allesbeste Farm. Seine ursprünglich aus Deutschland stammende Familie bewirtschaftet in der subtropischen Provinz Limpopo im Nordosten Südafrikas 630 Hektar mit Avocados und Bananen. Erstere werden erfolgreich in Europa vertrieben. Neuerdings kommt auf den weniger einfach zu bestellenden Hängen auch Kaffee dazu. „Wir sind überzeugt, dass der mit dem Klimawandel auch bei uns gut gedeihen kann. Und wir wollen verhindern, dass jemand sagt, unser Land wäre unproduktiv und könnte von jemand anderem übernommen werden.“
Ernst ist, wie viele andere Farmer, karitativ tätig, und bringt sich mit Hilfsprojekten in der lokalen Community ein. Auch das hat zwei Beweggründe: Zum einen will er tatsächlich etwas für die Dörfer in seinem Umfeld erreichen. „Zum anderen machen wir das, um die Stimmung für unsere Farm positiv zu halten.“ Niemand soll auf die Idee kommen, dass man die Familie nach sechs Generationen von ihrem angestammten Besitz vertreiben könnte. Auf einem anderen Kontinent zu leben würde ihm schwerfallen, sagt Ernst. „Wir haben afrikanisches Blut. Ich will auch meinen Kindern ermöglichen, hier aufzuwachsen. Ich werde nicht um Asyl bei Trump ansuchen.“
Einfach ist das Leben auch nach Abschaffung der Rassentrennung im Jahr 1994 nicht für die Schwarzen in Südafrika. Fast jeder zweite junge Mensch ist ohne Job. In ländlichen Regionen wie Limpopo ist der Anteil noch höher. Wenn jemand Arbeit findet, muss er oft die gesamte Großfamilie versorgen. Selbst wenn sie nur den Mindestlohn von umgerechnet 13 Dollar pro Tag bezahlen, sind die Farmen der Weißen, neben einigen Minen, die einzigen Unternehmen, die Leute in größerer Zahl anstellen. Diese nutzen die billige Arbeitskraft weidlich und halten oft tausende Hilfskräfte in Lohn und Brot.
Wirtschaftlich geht es den Nachfahren der Buren unvergleichlich besser. Sie genießen ein Leben nach westlichen Standards und haben eine höchst kompetitive Landwirtschaft aufgebaut. „Wir sind die besten Farmer der Welt, weil wir ohne Förderungen auskommen mussten und uns daher sehr effizient aufgestellt haben“, sagt Pieter Vorster von der Mahela Group, die nahe der Kleinstadt Tzaneen 1.360 Hektar Zitrusbäume und einige hundert Hektar an Avocados und Bananen ihr Eigen nennt. Das Unternehmen gehört heute zu den größten Agrarkonzernen Südafrikas. „Wir entwickeln uns konstant weiter, weil uns gar nichts anderes übrigbleibt“, so Vorster. Nachdem Europa zuletzt angekündigt hat, keine Produkte, die mit dort verbotenen Pestiziden behandelt wurden, mehr hereinzulassen, schwenkt man beim Export von Zitronen und Orangen erfolgreich Richtung Russland und Asien um. „Wir werden hierbleiben, weil wir uns hier Chancen sehen“, gibt sich Vorster trotzig.
Das Umfeld ist dafür ist aber alles andere als freundlich. „Oft haben wir zwei Stunden am Tag keinen Strom, weil die Infrastruktur marode ist und die Energie rationiert wird. Wir Farmer sind auch für die Sanierung der Straßen zuständig, weil sich sonst niemand darum kümmert.“ Die Sicherheitslage ist auch am flachen Land prekär, die Verbrechensrate hoch. Nachts frei bewegen kann man sich nicht, jedes Anwesen wird von Securities bewacht, die Plantagen sind mit Starkstromzäunen gesichert. Dennoch durchbrechen immer wieder Diebe die Umfriedungen, raffen so viele Früchte wie möglich an sich und sind längst über alle Berge, wenn das Sicherheitspersonal der Farmen ankommt. Was von schwarzen Marktstandlern tagsüber am Straßenrand als frische Ware verkauft wird, wurde nachts von den Großbetrieben der Weißen geklaut. „Die Polizei braucht man nicht rufen, die haben dann sowieso kein Auto frei“, sagt Pieter Vorster. Viele greifen da lieber zur, nicht immer gewaltfreien, Selbstjustiz. Nicht alle Farmer wollen unter solchen Bedingungen leben. „Dass unsere Gruppe so wachsen konnte, liegt daran, dass viele Kollegen ausgewandert sind und uns ihr Land verkauft haben“, so der Agrarunternehmer.
Zu all diesen Sorgen kommt noch die Unsicherheit, ob nicht doch ein künftiger Präsident auf die Idee kommen könnte, bei der großflächigen Enteignung Nägel mit Köpfen zu machen. So rief der radikale Oppositionspolitiker Julius Malema, der selbst aus der Provinz Limpopo stammt, recht unverhohlen zur Ermordung der weißen Farmer auf, indem er öffentlich ein Lied mit dem Titel „Erschießt die Buren“ anstimmte. Diese machen sich derweil gegenseitig Mut. „Südafrika ist viel zu stark von der Landwirtschaft abhängig“, meint Zander Ernst. Deshalb ist er davon überzeugt, dass es nicht wie beim Nachbarn Zimbabwe kommen wird, wo man die Weißen vertrieben und deren Eigentum an die Arbeiter verteilt hat. Mit dem Resultat, dass diese, mangels landwirtschaftlichen Grundwissens, kaum etwas ernten konnten und das ganze Land in eine Hungersnot stürzte.
Wenn es zu einer Umverteilung kommen soll, müssten die bisherigen Besitzer dementsprechend entschädigt und die neuen Bewirtschafter befähigt werden, dementsprechend ertragsbringend zu wirtschaften. Denn bisherige Versuche hätten nicht selten darin gemündet, dass die Häuptlinge ihre Günstlinge versorgt hätten und das Land brach lag, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Nicht selten hätten jene Farmer, denen die Grundstücke zuvor weggenommen wurden, diese danach wieder teuer zurückgekauft und erneut urbar gemacht. Ein Rezept dafür, wie die bedrückende Kluft in einem agrarisch reichen Land überbrückt werden kann, hat also niemand. Lösungen sind dringend gefragt, bevor das Pulverfass explodiert. Schrille Zurufe aus Washington helfen aber jedenfalls nicht, die Situation zu entspannen.
allesbeste.com
www.mahela.co.za