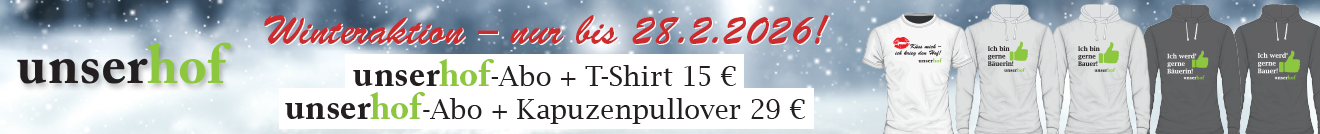Angst ist ein schlechter Ratgeber
Per Anfang Juni sind, wenn es zu keiner politischen Einigung kommt, Vollspaltenböden in Österreich offiziell verboten. Diese Ungewissheit und andere aktuelle Fragen bewegen KURT TAUSCHMANN von der styriabrid und seine Kollegen. STEFAN NIMMERVOLL im Gespräch.
Wie nervös sind sie, dass große Teile der Branche ab Anfang Juni illegal arbeiten werden?
Ich habe nach wie vor Vertrauen in die Politik, dass sie das Problem, bevor es ins Illegale geht, lösen wird.
Was hören Sie hinter den Kulissen?
Dass die Verhandlungen sehr intensiv sind und dass es bereits in den nächsten Wochen eine Einigung geben wird.
Was wäre denn eine realistische Übergangsfrist für den Umbau, mit dem die Branche leben könnte?
Das ist schwierig. Wir haben uns ja Gedanken gemacht, als wir die ursprüngliche Übergangsfrist mit 2039 festgelegt haben. Denn wir haben mit der freien Abferkelung eine zusätzliche Herausforderung bei den Ferkelerzeugern. Sie müssen bis 2033 die Abferkelbuchten umbauen. Unser Fahrplan wäre gewesen, bis dahin zu schauen, dass wir die Ferkelbetriebe förderungstechnisch gut versorgen, weil dort die Investitionssummen viel höher und die Umbauten viel komplizierter sind als in der Schweinemast. Ab dann wollten wir bei den Vollspaltenböden schauen, dass wir die Betriebe umbauen.
Welche Schwierigkeiten bringt das mit sich?
Die größte Herausforderung wird sein, die Österreicher mit heimischem Schweinefleisch zu versorgen. 70 bis 80 Prozent der Betriebe, mit denen wir reden, sagen, dass die mit der Ferkelerzeugung aufhören werden.
Warum?
Das Problem ist die Größe der Abferkelbucht. Bei den bestehenden Betrieben passt nichts zusammen. Man kann nicht nur die alten Buchten herausreißen und die neuen hineinbauen, weil sich das platztechnisch nicht ausgeht. Wer heute 80 Zuchtsauen hat, hat dann nur mehr 50. Dazu kommt das Problem mit den Genehmigungsverfahren, wenn ich baulich etwas verändere. Deshalb arbeiten wir daran, dass es ein vereinfachtes Verfahren gibt, wenn ich meinen Tierbestand nicht erweitere.
Weniger Ferkel wären ein Problem beim AMA Gütesiegel.
Richtig. Die Frage ist jetzt, wie man die Rahmenbedingungen gestaltet, damit wir mehr Bauern motivieren können, die hohen Investitionskosten im Ferkelbereich doch zu stemmen und weiterhin Ferkel zu erzeugen.
Der Staat ist klamm. Wird es überhaupt genug Förderungen geben, damit man alles, was man sich für die Schweinebranche vornimmt, umsetzen kann?
Vor dem Sparpaket ist nach dem Sparpaket. Die Frage ist, ob uns die Aufrechterhaltung der Schweinewirtschaft etwas wert ist. Denn in Wahrheit macht diese Förderung, auf das Gesamtbudget des Staates betrachtet, nicht viel aus.
Welche Summen stellen Sie sich da vor?
Die Fördersätze mit 25, 30 und 35 Prozent der Investitionssumme passen grundsätzlich. Das größere Problem ist die Förderobergrenze bei 700.000 Euro. Jeder, der sich mit der Baubranche beschäftigt, weiß, was sich in den letzten Jahren alles verteuert hat. Bei einem Zubau ist eine Million Euro heute wenig Geld. Wenn ich dafür 200.000 Euro bekomme, bin ich de facto nur mehr bei 20 Prozent.
Bis Ende 2027 läuft noch das Projekt iBest, in dem Empfehlungen für Umbauten in konventionellen Schweineställen erarbeitet werden soll. Gibt es bereits erste Ergebnisse daraus?
Intern ja. Wir probieren vieles aus, weil wir den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden wollen. Nichtsdestotrotz haben wir auch die wirtschaftlichen Zwänge. Wenn die Bauern kein Licht am Ende des Tunnels sehen, werden sie aus der Produktion aussteigen.
Soll man mit Investitionen noch warten, bis iBest fertig ist?
Die Bauern warten sowieso. Früher haben sie die Mischmaschine angeworfen und den Stall größer gemacht, wenn der Schweinepreis gut war. Jetzt sind die Schweinepreise gut, es wird aber nichts investiert. Das ist auf die Unsicherheit zurückzuführen, dass keiner weiß, wie der Stall der Zukunft ausschauen wird.
Die Schweinebranche hat sich für 2030 vorgenommen, eine Million Tierwohl-Schweine zu produzieren. Wie gut ist man dabei am Weg?
Die Aussage hat sich relativiert, weil der Markt uns etwas ganz anderes zeigt. Aus heutiger Sicht werden wir das Ziel nicht erreichen. Wir können nur das produzieren, was am Markt umsetzbar ist. Der Konsument ist einfach nicht bereit, für eine Million Tierwohl-Schweine in Österreich das Geld auszugeben.
Ist das jetzt der Pendelausschlag in die andere Richtung, nachdem bei Corona Qualität im Fokus gestanden ist?
Ja, ist es schon. Als Corona gekommen ist, waren die Bauern und die Direktvermarkter die Helden der Nation. Jedem war bewusst, dass wir nicht mehr alles von überall her bekommen. Dann sind der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation gekommen. Auf einmal war nur mehr billig am Markt umsetzbar. Wie schnell sich der Markt drehen kann, hat mich geschockt.
Dabei ist der Schweinepreis aber eigentlich gar nicht so schlecht.
Die Schweinepreise sind gut. In der Veredelung hat man in der Vergangenheit Geld verdient und man wird auch in der Zukunft Geld verdienen können. Die höheren Preise brauchen wir aber, weil die Inflation auch in der Landwirtschaft voll durchgeschlagen hat.
Werden sich die guten Preise langfristig halten können, wenn zu wenige Schweine am Markt sind?
Bisher hat sich die Produktion an die Marktsituation angepasst: Wenn zu viel da war, sind die Preise hinunter gegangen, wenn zu wenig da war, hinauf. Den großen Umschwung, bei dem wieder viele einsteigen und ein Überschuss da sein wird, sehe ich aber in ganz Europa nicht. Die letzten die Gas gegeben haben, waren die Spanier, weil sie sehr günstig bauen konnten. Nicht einmal dort sind mehr Wachstumsschritte da.
Auch in Deutschland gibt es einen massiven Rückgang der Bestandszahlen.
Wir sehen, wie schwierig es ist, wenn die Politik etwas vorgibt, was am Markt nicht umsetzbar ist. Eigentlich müssten wir Minister Özdemir dankbar sein, weil wir sehr eng mit Deutschland verbunden sind. Deutschland ist der Markt, der den Preis vorgibt.
Und in Österreich ist das besser?
Das österreichische Erfolgsrezept ist, dass sich die Produzenten, die Schlachthöfe und die Handelsketten an einen Tisch setzen und gemeinsam ausreden, was machbar ist. In Deutschland richten sich diese Leute gemeinsam die Grauslichkeiten aus. Auf diesen österreichischen Weg, zu reden, was geht und was nicht, bin ich stolz.
Aber tun die Handelsketten genug, um die Tierwohl-Programme zu einem Erfolg zu machen?
Mit einer Handelskette (Anm. REWE) gibt es eine gute Beziehung. Die Bauern verdienen sehr gut. Wer einen Vertrag bekommt, soll in Tierwohl investieren. Das sind aber nur zwei Prozent der Schweinefleischproduktion.
Wird der Konsument langfristig für mehr Tierwohl mehr Geld ausgeben?
Es wird eine Schicht geben, aber es wird nicht die Masse sein. Wir Bauern haben absolut kein Problem, mehr Platz zu machen und mehr Tierwohl anzubieten. Mehr Tierwohl kostet aber mehr. Wenn es am Markt nicht bezahlt wird, kann ich es nicht machen. Also müssen wir auch die Basisqualität anbieten, um für jeden etwas im Programm zu haben.
Der Konsum von Schweinefleisch geht generell zurück. Muss die Branche zwangsläufig schrumpfen?
Wir sind davon ausgegangen, dass der Schweinefleischkonsum stärker zurückgeht. Der vegane und vegetarische Trend flacht aber ab. Wir haben in Österreich im Vorjahr ungefähr 4,4 Millionen Schweine geschlachtet. In zehn Jahren werden wir ungefähr 3,8 bis 4 Millionen Schweine brauchen, um die Eigenversorgung zu gewährleisten. Das wäre ein Rückgang von zehn Prozent.
Braucht es die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie?
Es tut mir leid, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen, weil in Wahrheit preislich kein Unterschied ist. Ich erwarte mir von der Gastronomie mehr Patriotismus. Sie könnte auch freiwillig auf Österreich setzen. Man muss nicht immer alles gesetzlich verordnen.
Und eine Kennzeichnung der Haltungsform?
Wenn es der Gesetzgeber bei uns haben will, werden wir es umsetzen. Auskennen tut sich aber sowieso kein Konsument, egal ob jetzt 1, 2 oder 3 draufsteht. Da ist Deutschland massiv vorgeprescht. Jetzt rudert man massiv zurück. Die bittere Erkenntnis ist, dass der Konsument kauft, wenn der Preis billig ist.
Man hört aber, dass das AMA-Gütesiegel an das deutsche System angepasst werden soll.
Es sind Bestrebungen da. Ich verstehe aber nicht ganz, warum wir uns anpassen sollen. Anders als bei der Milch exportieren wir nicht viel Fleisch nach Deutschland. Wir haben das Problem, dass deutsche Schweine nach Österreich kommen und nicht umgekehrt.
Nicht weit von ihrem Betrieb, in Ungarn, mussten Rinderherden und Schweinebestände gekeult werden. Wie groß ist die Angst vor einem Ausbruch in der Steiermark?
Die Ungarn haben sehr schnell reagiert. Ich hoffe, dass sie das eindämmen können und dass das bald Geschichte sein wird.
Die gekeulten Tiere wurden einfach in Gruben geworfen. Das hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie da eine Desinfektion funktioniert. Ich wüsste aber auch nicht, wie die steirischen Tierkörperverwerter auf einmal tausende Rindviecher verheizen könnte.
Wie groß ist die Angst vor einem Ausbruch in der Steiermark?
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir haben solche immer vor der Afrikanischen Schweinepest gehabt. Mit der Maul- und Klauenseuche hat keiner gerechnet.
Gibt es dafür Krisenpläne?
Für die Afrikanische Schweinepest ja, aber nicht für die Maul- und Klauenseuche. Wie ich unsere Beamten kenne, wird aber sicher daran gearbeitet.
Bei den Rindern und beim Geflügel gibt es verschiedene andere Seuchen. Haben Sie schon einmal eine solche Situation erlebt?
Nein – und ich hätte es mir gerne erspart. Die Bilder der Kadaver, die herumschwirren, sind unerträglich. Darunter muss die Psyche der Betriebsführer enorm leiden.
Gibt es irgendeine Erklärung, warum plötzlich so massiv Seuchen auftreten?
Darüber diskutieren wir auch sehr viel. Was mir Sorge bereitet, ist, dass man nicht weiß, woher es kommt. Ohne Ursache kann man nicht richtig darauf reagieren. Wenn eine Wasserbüffelhaltung in Brandenburg isoliert betroffen ist, muss man sich fragen, wo das herkommt? In Ungarn wird darüber spekuliert, dass die MKS über einen Melker aus Ägypten eingeschleppt wurde.
Was hat sich für Sie auf ihrem Betrieb geändert?
Wir sind nicht in der Beobachtungszone. Deshalb ist es gefühlt weit weg und lässt sich leichter verdrängen. Die Sorge ist aber groß. Momentan betreten bei uns keine betriebsfremde Person den Schweinestall, egal ob bekannt oder nicht. Denn ich weiß auch nicht, wo meine Nachbarn spazieren fahren.
Bei den Schweinen war die Betriebssicherheit schon vorher hoch. Bei den Rindern ist man es gewohnt, dass die Ställe offen sind. Muss man sich auch dort etwas überlegen?
Die gesamte tierhaltende Landwirtschaft muss viel intensiver schauen, wer wo aus- und eingeht. Der Chauffeur, der die Schweine abholt, kommt bei uns nicht in den Stall hinein, weil er in der ganzen Steiermark herumfährt. Der steht an der Rampe und treibt die Tiere hinaus. Das müssen auch die Rinderbauern momentan berücksichtigen.
Wird man sich daran gewöhnen müssen, dass es in Zukunft keinen Zutritt mehr zu Nutztierbeständen geben wird?
Wir müssen einerseits dafür Bewusstsein schaffen, dass man vorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite müssen wir aber herzeigen, was wir tun. In diesem Lichte ist es unlogisch, dass auch meine Stallungen versperrt sind. Wenn wir haben wollen, dass die Konsumenten Schweinefleisch essen, muss ich ihnen auch zeigen können, wie die Schweine gehalten werden.
Kurt Tauschmann ist seit 12 Jahren und noch bis Anfang Juli Obmann der Styriabrid. Er hat einen Betrieb mit zirka 2.000 Schweinemastplätzen und einer Biogasanlage in Großwilfersdorf in der oststeirischen Thermenregion.