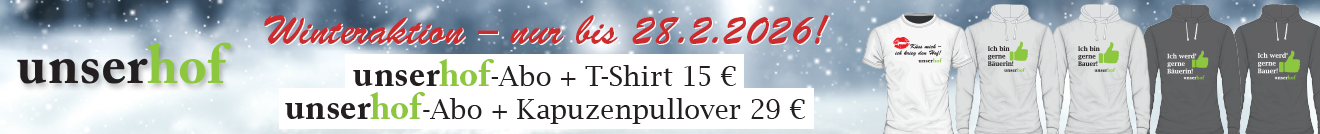NGT-Potential nicht vernachlässigen
Während sich neue genomische Techniken weltweit anschicken, den Pflanzenbau revolutionieren, quält sich Europa mit der Frage der Zulassung. Saatbau Linz-Geschäftsführer JOSEF FRAUNDORFER plädiert im Interview mit STEFAN NIMMERVOLL dafür, nicht den Anschluss zu verlieren.
Wie schafft es eine bäuerliche Genossenschaft, im Wettstreit mit internationalen Agrarindustriegiganten zu bestehen?
Natürlich haben wir nicht so viel Geld wie die internationalen Multis. Deswegen müssen wir effizienter arbeiten. In der Züchtung und in der Entwicklung von neuen Sorten müssen wir auf demselben Niveau sein wie die Großen. Dazu braucht es nicht nur die Wissenschaft, sondern auch Leute, die verstehen, was ein Bauer braucht. Unsere Nähe in der Genossenschaft bringt eine Bindung zum Landwirt.
Ist die gewaltige Strukturbereinigung in der Züchtung aus bäuerlicher Sicht ein Problem?
Wenn man hier züchtet, ist man darauf fokussiert, regional angepasste Sorten zu entwickeln. Wir haben einen Qualitätsweizen, der international in dieser Dimension nicht üblich ist. Zusätzlich haben wir Winterdurum und Winterbraugerste entwickelt. Diese Nischen bringen Wertschöpfung für die Bauern und werden von internationalen Konzernen nicht bedient.
Sie sind aber auch im Export erfolgreich. Was macht den Züchterstandort Österreich dabei attraktiv?
Beim Getreide sind wir von Österreich Richtung Osten ausgerichtet. Da geht es um Hitzetoleranz, Trockenstress, Winterhärte und hohe Qualität. Richtung Westeuropa und Norden tun wir uns damit schwer. Beim Mais selektieren wir für die Märkte. Da ist der Standort nicht ganz so entscheidend. Besonders erfolgreich sind wir bei der Sojabohne. Da gehen wir vom Marktanteil in Europa Richtung 30 Prozent. Der Sojamarkt ist in den letzten 20 Jahren auch Richtung Norden gewachsen. Da haben wir uns genau auf die richtigen Reifegruppen konzentriert. Wir sind haben ein System mit der zweiten Generation in Costa Rica entwickelt, mit dem wir relativ schnell neue Sorten entwickeln können. Das können nicht alle.
In welche Richtung gehen denn momentan die wichtigsten Projekte?
Es wird wärmer, die Hitzetage und Trockenperioden werden mehr. Diese Stresstoleranz hineinzubringen, steht im Vordergrund, egal ob bei Weizen oder Mais. Aber nicht nur: Auch in einem Jahr wie heuer, wo es zur Ernte regnet, braucht es Standfestigkeit und Auswuchsfestigkeit. Und wir suchen nach Resistenzen gegen Krankheiten – egal ob es Gelbrost oder Gelbverzwergungsvirus, wo Epidemien bevorstehen, ist.
Welche Rolle spielen neue Züchtungstechnologien im internationalen Wettbewerb?
Sie bieten ein Potential für die Zukunft, das man einfach nicht vernachlässigen kann. Man kann damit exakter und rascher zu der gewünschten Eigenschaft. Wenn ich beim Mais eine spezielle Stärke für die Verarbeitung in der Industrie brauche, komme ich dazu viel schneller als mit herkömmlicher Züchtung. Wir stehen aber erst am Beginn der Entwicklung. Außerhalb Europas beschäftigt man sich intensiv mit dem Bereich. Seit die Briten aus der EU ausgetreten sind, haben sie sich darauf konzentriert. Damit entstehen vor unserer Haustür Firmen, die das abbilden.
Ist das die nächste Revolution in der Züchtung?
Das werden wir in 50 Jahren wissen. Momentan sehen wir das nicht so, aber es ist ein Baustein, den wir in der Werkzeugkiste haben.
Die Österreicher sind bei grüner Gentechnik fast gleich stark ablehnend eingestellt wie bei der Atomkraft. Ist es trotzdem vernünftig, die Technologien einzusetzen?
Das Thema ist komplex. Deswegen sind Ängste da, die man durchaus berücksichtigen muss. Es gibt aber mittlerweile Umfragen, die ergeben, dass die Ablehnung der neuen Züchtungsmethoden in der Bevölkerung bei weitem nicht mehr so hoch ist, wie es früher in der herkömmlichen Gentechnik war. Es ist Aufgabe der Branche, den volkswirtschaftlichen Nutzen, nicht nur für den Züchter, darzustellen. Ordentlich produzierte, preisstabile Lebensmittel bringen allen etwas. Wenn die Technologie nur einem internationalen Großkonzern etwas bringt, hat keiner etwas davon.
Sind Dinge wie CRISPR/Cas9 jetzt Gentechnik oder nicht?
Die Mutationszüchtung gibt es schon lange. Es ist nur ein anderer Weg, um das Ziel zu erreichen. Das Ergebnis unterscheidet sich am Ende des Tages nicht von der bisherigen konventionellen Züchtung. Das Endprodukt ist das gleiche. Der Nachweis ist gar nicht leicht und manchmal nicht möglich.
Braucht es eine Kennzeichnung am Lebensmittel aus Sorten, die damit gezüchtet wurden?
Dazu gibt es in den Trilogverhandlungen in der EU unterschiedliche Positionen. Eine Kennzeichnung bis zum Endprodukt geht aber nicht. Wenn das gemacht werden würde, bräuchten wir unterschiedliche Warenströme. Das ist derartig teuer, dass die Wirtschaftsverbände und die Lebensmittelindustrie strikt dagegen sind.
Nimmt man sich damit nicht den gewaltigen Marktvorteil der Gentechnikfreiheit bei vielen Lebensmitteln weg?
Das Saatgut ist ja gekennzeichnet. Wenn es Projekte gibt, wo einer das nicht will, ist das weiterhin möglich. Und der Bio-Bereich ist komplett heraußen.
Wie wird die politische Entscheidung letztendlich ausschauen?
Die Ablehnung ist besonders stark in Österreich und in einigen Nachbarländern. Die qualifizierte Mehrheit ist aber für diese Technologie, sonst wäre es gar nicht zu den Trilogverhandlungen gekommen. Die Positionen sind in Wahrheit also gar nicht so weit auseinander.
Im Vergleich zu den Großen fehlt ihnen eine Agrochemie-Sparte. Dennoch kämpfen sie für den Erhalt von Wirkstoffen. Merken Sie deren Fehlen in ihrem Geschäft?
Auf europäischer Ebene werden die Wirkstoffe massiv reduziert. Natürlich trifft es als erstes immer die Nischenkulturen. Wenn eine Pflanze krank ist, muss ich die Möglichkeit erhalten, dass ich das Saatgut beize oder sie danach gesund erhalte, sonst geht sie zugrunde. Wenn ich diese Ertragsstabilität nicht habe, wird die Kulturart verschwinden. Dann wird außerhalb der EU produziert und kommt wieder herein. Ob das im Sinne der Versorgungssicherheit ist, möchte ich in Frage stellen.
Inwiefern kann denn Züchtung den fehlenden Pflanzenschutz ersetzen?
Sie ist ein wesentlicher Hebel, um Widerstandfähigkeit hineinzubringen. Eines ist aber klar: Die Züchtung braucht Jahre, um das zu erreichen. Viel schneller als in zehn Jahren geht das nicht. Zudem kommen immer wieder neue Krankheiten daher, die wir vor fünf Jahren noch nicht gehabt haben
Werden wir mit der aktuellen Politik die Versorgungssicherheit aufrecht erhalten können?
So, wie die derzeitig Agrarpolitik in der EU ausgerichtet ist, wird das zumindest in Österreich schwierig, weil es parallel dazu einen Klimawandel gibt, der Erträge reduziert und auch Kulturartenveränderung mit sich bringt. Wir als Züchter können nur versuchen, diesen Prozess zu verlangsamen. Irgendwann ist aber das Ende der Fahnenstange der Möglichkeiten der Landwirte erreicht. Wenn uns die Betriebsmittel fehlen, wird es Jahre geben, wo ich überhaupt nichts mehr ernte, wie es bei den Kartoffeln bereits der Fall war. Aber vielleicht will man ja politisch gar nicht, dass man in Zukunft Lebensmittel in der EU produziert?
Liegt das Hauptproblem in Brüssel oder auch in Österreich?
Die Agrarpolitik wird ganz klar in Brüssel gemacht. Der österreichische Landwirtschaftsminister kann mitwirken, aber er alleine kann es nicht verändern.
Nach den Bauernprotesten ist der Landwirtschaft einiges an Vereinfachungen versprochen worden. Wie viel davon ist wirklich angekommen?
Wir haben noch nichts gemerkt davon. Aber vielleicht kommt es noch.
Was braucht es, damit die europäische Landwirtschaft im internationalen Umfeld reüssieren kann?
Wettbewerbsfähigkeit. Man muss anschauen, zu welchen Kosten man Dinge herstellen kann. Neben der Qualität, die in Europa unbestritten vorhanden ist, brauche ich auch Leistungsfähigkeit. Dazu dürfen die Preise für Betriebsmittel nicht um 30 oder 50 Prozent höher sein als im Rest der Welt.
Auch die Preise für Saatgut sind eine finanzielle Belastung für die Landwirtschaft.
Der größte Preissprung war 2022, als die Preise für die Konsumware gestiegen sind. Das Grundprodukt für Saatgut ist einfach der Weizen. Wenn der Preis dafür auf- und ab schwankt, geht auch der Saatgutpreis mit. Deshalb ist der mittlerweile auch wieder runtergegangen. Dann spielen natürlich auch Faktoren wie die Inflation eine Rolle. Wenn wir beim Mais mit Gas trocknen, hat das einen Effekt auf den Preis.
Ein Ausweg für die Bauern wäre der Nachbau. Sie werden vermutlich eher für Originalsaatgut plädieren.
Durch den Saatgutkauf entscheidet der Landwirt, ob in die Züchtung investiert wird oder nicht. Wenn der Fortschritt weitergeht, kommt das wieder beim Landwirt an. Die kleinen Getreidezüchter haben kein Geld mehr verdienen können, deshalb bleiben nur mehr die großen über. Es gibt Kulturarten, wo es kaum mehr Züchtung gibt, wie zum Beispiel bei der Körnererbse, beim Hafer oder beim Linienroggen. Wenn das Ertragsvermögen nicht mehr steigt, wird die Diskrepanz immer größer, zum Beispiel zum Mais, wo viel Geld investiert wird.
Wären Lizenzgebühren für den Nachbau ein Ausweg?
Damit könnte man eine nachhaltige Züchtung ebenfalls finanzieren. Es gibt sie in fast allen Ländern Europas. In Österreich haben wir das Thema bis heute nicht umgesetzt.
Der nächste Schritt wäre dann die Patentierung von Saatgut.
Das ist ein großes Sorgenkind von uns, weil uns das im Zuge der neuen Züchtungstechnologien massiv betreffen wird. Damit besteht die Gefahr, dass der Fortschritt verhindert wird. Wenn nur mehr wenige die Patente in der Hand haben, drängen sie irgendwann die kleinen Züchter aus dem Markt hinaus.
Nach der Matura 1986 an der HLBLA St. Florian begann die Berufstätigkeit von Josef Fraundorfer der Saatbau Linz eGen. als erster Außendienstmitarbeiter. Es folgten Stationen als Verkaufsleiter für Österreich und als Verantwortlicher für den internationalen Vertrieb. 2013 hat Fraundorfer die Geschäftsführung der Saatbau Linz übernommen, einem international agierenden Unternehmen mit rund 530 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von rund 262 Mio. Euro.