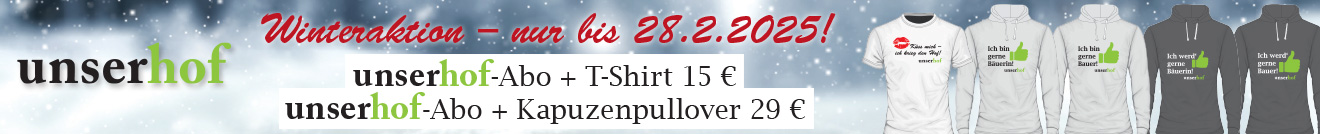Siegel-Check bei den Nachbarn
Gütesiegel wie jenes der AMA-Marketing haben ihren Nutzen, stehen aber manchmal auch in der Kritik. STEFAN NIMMERVOLL hat sich in Deutschland und der Schweiz exemplarisch mit zwei ähnlichen Systemen befasst.
Deutschland hatte, was Österreich noch hat: Bis 2009 (und schon seit 1970) bestand die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA). Wie hierzulande die AMA-Marketing finanzierte sie sich aus Zwangsabgaben entlang der Wertschöpfungskette. Das schmeckte nicht allen, eine Klage bedeutete schließlich ihr Ende. Seither dominieren unzählige private Labels den Markt.
Größere Bedeutung erlangte die vierstufige Kennzeichnung der Initiative Tierwohl (ITW), die Fleischerzeugnisse nach ihrer Haltungsform kategorisiert. Um das Chaos perfekt zu machen, wird dieses Ampelsystem nun an eine neue staatlich verpflichtende Haltungsformkennzeichnung mit fünf Stufen angepasst. Zumindest zu Beginn werden bei einigen Produktgruppen beide Logos parallel auf den Verpackungen aufscheinen. Ob sich der Konsument in dem Wirrwarr auskennen wird, scheint dessen Erfinder nicht zu kratzen.
Über die Herkunft sagen die Tierwohl-Siegel jedenfalls nichts aus. Hier kommt eine dritte Idee, das Kennzeichen „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“, ins Spiel. Dieses wird von einer Zentralen Koordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL) angeboten. „Wir tragen zu einer nachhaltigen Wertschätzung und Stärkung der heimischen Landwirtschaft bei und geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wichtige Orientierungshilfe“, meinte Geschäftsführer Peter Jürgens bei einer Vorstellung des Programms vor österreichischen Journalisten in Berlin.
Das freiwillige Siegel kennzeichnet Agrarprodukte, die vollständig in Deutschland erzeugt, verarbeitet und verpackt wurden. Verglichen mit der AMA-Marketing ist die Kriegskasse des Vereines aber relativ leer. Pro Handelskette werden gerade einmal 50.000 Euro Mitgliedsbeitrag eingehoben. Der Gesamtetat beträgt schlappe 300.000 Euro.
„Wir können also selber keine Marketingkampagnen starten. Das müssen unsere Handelspartner machen“, sagte Jürgens.
„Wir machen die Einführung auch nicht mit der gesetzlichen Brechstange, sondern über den Markt. Wenn das Ding fliegt, ist es O. K., wenn nicht, ist es in zwei Jahren wieder verschwunden.“ Zumindest ist man froh, alle relevanten deutschen Lebensmittelketten mit an Bord zu haben. Bei diesen habe man angesichts von Blockaden der Zentrallager durch die Bauern erkannt, dass ein Entgegenkommen billiger ist als das Schreckensszenario eines Tages Stillstand.
Geregelt wurde das Herkunftssiegel in einer umfangreichen Branchenvereinbarung, die Kriterien für die gekennzeichneten Produkte festlegt und sicherstellt, dass nur solche, die diesen entsprechen, das Zeichen tragen. Jürgens äußerte die Hoffnung, dass damit schrittweise die LEH-eigenen Labels verschwinden und man sich auf das konzernübergreifende Kennzeichen einigen kann. „Eine Zeitlang wird es in jedem Fall Doppelgleisigkeiten geben“, gibt er sich keinen Illusionen hin. Der Fokus liegt im Moment auf Fleisch, Gemüse und einfachen Verarbeitungsprodukten, meist als Handelsmarke.
Auf die Bauern kommt kaum zusätzlicher Aufwand zu. „Wir gehen nicht in den Stall und schauen, ob dort deutsche Ferkel stehen, sondern wir arbeiten Checklisten anhand bereits bestehender Kontrollen ab“, so Jürgens. Er räumt ein, dass das ZKHL-System „null Qualitätsanforderungen hat, sondern nur die Herkunft abbildet“. De facto würden die Handelsketten parallel aber ohnehin auch gewisse Standards einfordern. „Wir sehen, dass seit dem offiziellen Start im letzten September immer mehr zeichenfähige Artikel in den Regalen liegen.“
Jürgens hofft, dass die Nachfrage so groß wird, dass ein Sog in Richtung weiterer Artikel mit schwarz-rot-goldenem Fähnchen entsteht. Letztlich solle dadurch mehr Geld auf die Höfe kommen. Entscheiden wird schlussendlich der Konsument. „Der Fokus liegt aber beim Handel. Denn er setzt es bei den Herstellern durch. Wer es kann, der darf liefern.“
Die Schweizer Bauern produzieren unter verschärften Bedingungen. Kaum anderswo verlangt die Gesellschaft der Landwirtschaft derartig viel ab. Gleichzeitig produzieren die Höfe zu besonders hohen Kosten. Der Preiseinstieg lässt sich damit nicht bedienen, Lebensmittel in diesem Segment werden oftmals eingeführt.
Der Selbstversorgungsgrad mit Agrarprodukten liegt in Folge nur bei etwas über 50 Prozent. „Unser Preissystem ist dreistufig aufgebaut. An der Basis stehen preissensible Produkte, an der Spitze Bio. Dazwischen sind wir“, sagt Nicole Ramsebner, die Verantwortliche für Nachhaltigkeit bei der Schweizerischen Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen, IP-SUISSE. Diese bringt Lebensmittel mit Mehrwert, die aber eben nicht biologisch produziert werden, auf den Markt.
Deren Herkunft muss dabei zu hundert Prozent aus der Schweiz sein. Bei Brotweizen deckt das Programm ein Drittel der Schweizer Produktion, bei Schweinen 30 Prozent ab. Entstanden ist die IP-SUISSE bereits 1989 als Idee einer Gruppe befreundeter Bauern. Zunächst wurde Getreide unter dem Label vermarktet, später folgten auch Tiere. Die Besonderheit dabei ist, dass die Vereinigung nicht nur das Marienkäfer-Siegel vergibt, sondern auch selbst mit Getreide, Ölsaaten und Proteinpflanzen handelt und an einer Viehhandelsfirma und einer Käserei beteiligt ist. „Wir haben einen Jahresumsatz von 100 Millionen Franken“, so Ramsebner, „der Gewinn ist aber relativ klein, weil wir im Interesse unserer Landwirte arbeiten und als Verein nicht gewinnorientiert sind.“
Der Basispreis für die Produkte entsteht dabei am freien Markt, die Aufschläge für Verbandsware werden im Dialog zwischen den Vertretern der IP-SUISSE und den Lebensmittelketten ausgehandelt. Mit an Bord sind mit Migros und COOP die beiden Großen im Schweizer Detailhandel. Mit ihnen existieren langjährige Vereinbarungen. Der Aufschlag bei Getreide beträgt zwischen fünf und 15 Prozent des Warenwertes, für pestizidfreie Ware sogar fast 25 Prozent. Zuletzt konnten Prämien in der Höhe von 65 Mio. Franken ausbezahlt werden.
Der Mitgliedsbeitrag ist mit 80 Franken pro Betrieb moderat, bei Tieren fallen noch zusätzliche Abgaben pro Stück Schlachtvieh an. Strategische Entscheidungen werden vom durch die Delegiertenversammlung gewählten bäuerlichen Vorstand des Vereines getroffen. Insgesamt verschreiben sich rund 10.000 der 48.000 Schweizer bäuerlichen Betriebe der integrierten Produktion über die IP-SUISSE. Dazu kommen noch 7.500 Biobetriebe. Ein wesentlicher Teil des Einkommens kommt auch für sie über die öffentlichen Zahlungen. „Wir erhöhen dann die Wirtschaftlichkeit der nachhaltigen Landwirtschaft durch die Zuschläge“, meint Ramsebner.
Was die Produzenten dürfen, ist in einem umfangreichen Regulativ festgeschrieben. „Uns ist es wichtig, dass unsere Vorgaben kompatibel mit den staatlichen Programmen sind, um den bürokratischen Aufwand gering zu halten.“ Wie ein Hersteller sein Siegel erreicht, ist teilweise flexibel: „Wir arbeiten zum Beispiel bei der Biodiversität nach einem Punktesystem. Die Bauern können sich aus 32 Maßnahmen jene raussuchen, die für sie am besten passen.“ Fruchtfolge und das Verbot riskanter Wirkstoffe sind im Ackerbau selbstredend. In der Viehhaltung setzt man auf grasbetonte Produktion. Gezeichnet wird aber nur so viel Ware, wie der Markt verträgt: „Im Vorjahr sind wir erstmals mit Ackerbohnen und Eiweißerbsen für Fleischersatz gestartet. Diese liegen noch auf Lager, daher gibt es heuer einen Anbaustopp.“